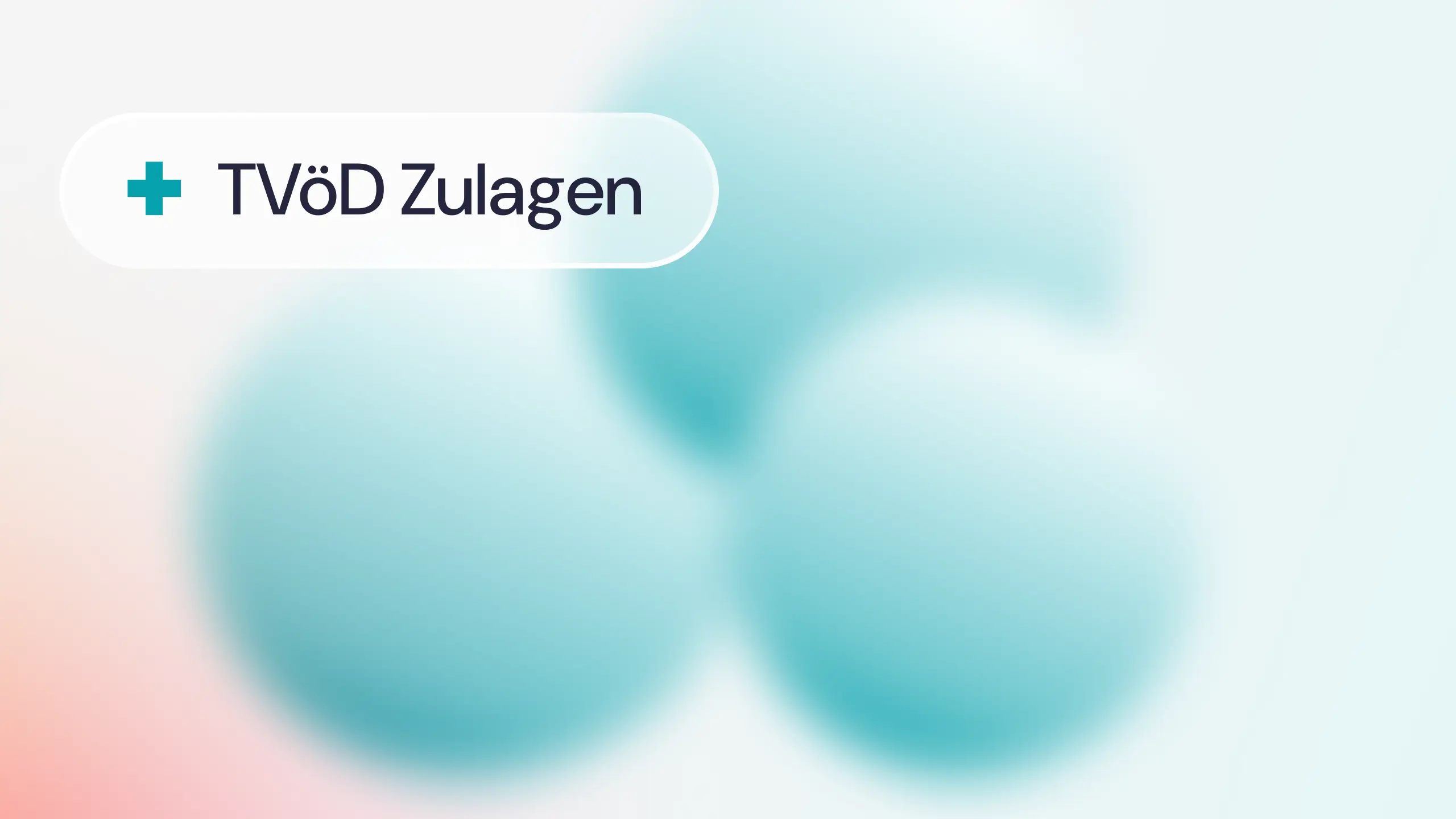„Wenn du ein Budget erstellst und dich daran hältst, wird es plötzlich so aussehen, als hättest du Geld“, sagt der amerikanische Geschäftsmann Dave Ramsey. Und damit hat er recht. Wer sich mit effektiver Budgetplanung auseinandersetzt, einige Tipps beachtet und eine Vorlage benutzt, für den ist das Handling von Ausgaben und Einnahmen ganz einfach.
Wie man verhindern kann, in Zahlungsverzug zu kommen, offene Rechnungen oder Kredite nicht mehr bedienen zu können oder gar in die Insolvenz zu rutschen, erklären wir in diesem Blog-Beitrag.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Budgetplanung ist ein Instrument, mit dem finanzielle Ressourcen mittels strategischer Planung sinnvoll verwaltet werden.
- Die Planung eines Budgets steuert die Verwendung von Geldern innerhalb des Unternehmens, um die Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Ihre zentrale Aufgabe ist es, den Fortbestand eines Unternehmens zu sichern.
- Mögliche Überausgaben können vermieden, Schulden abgebaut und Rücklagen gebildet werden. Das gibt finanzielle Stabilität sowie Planungssicherheit und gewährleistet die Liquidität.
Definition: Was ist eine Budgetplanung?
Eine effektive Budgetplanung ist entscheidend für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens oder eines Haushalts. Die Budgetplanung ist ein Instrument, mit dem finanzielle Ressourcen aufgrund von Planung strategisch sinnvoll verwaltet werden. Ziel ist es, anhand von Budgetvorlagen und -plänen Ausgaben und Einnahmen besser zu organisieren.
Die Budgetplanung bzw. die Budgetierung als betriebswirtschaftlicher Finanzplanungsprozess umfasst das Steuern von Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens für einen festgelegten Zeitraum. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Firma nicht mehr Geld ausgibt, als es wirtschaftlich gesehen vertretbar ist.
Mittels der Budgetplanung wird die Verwendung von Geldern innerhalb der Firma bzw. für das Unternehmen gesteuert, um die Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Ihr fällt somit eine zentrale Aufgabe zu, um den Fortbestand eines Unternehmens zu sichern. Geschäftsführung, Finanzteams und das obere Management sollten dazu dringend involviert sein.
Die Koordination des Budgetierungsprozesses ist sehr wichtig. Dazu bedarf es klarer Kommunikation zwischen allen Beteiligten, um alle Teilbudgets aufeinander abzustimmen.
Weshalb ist Budgetplanung wichtig?
Die Budgetplanung hilft dabei, eine Firma effizient zu verwalten und finanzielle Ressourcen besser zu monitoren. Sie ist ein wichtiger Teil des Finanzmanagements.
Dank des Controllings über die Finanzen können Ziele effektiver verfolgt und auch erreicht werden. Mögliche Überausgaben können vermieden, Schulden abgebaut und Rücklagen gebildet werden. Das gibt finanzielle Stabilität und Planungssicherheit. Moderne Budgetierung sichert die Liquidität eines Unternehmens.
Welche Arten der Budgetplanung gibt es?
Die Planung des Budgets geschieht der Betriebswirtschaftslehre zufolge anhand von drei Arten. Alle umfassen eine Budgetplanung sowie Budgetkontrolle im Sinne des operativen Controllings.
Die operative Budgetplanung erstreckt sich auf ein Geschäftsjahr und umfasst somit zwölf Monate. Sie ist daher kurzfristig und detailliert ausgerichtet. Es werden die zur Verfügung stehenden Mittel geprüft und abgewogen, welche Ziele damit verfolgt werden sollen. Sie ist dafür geeignet, laufende Kosten zu überwachen und operative Bewegungen der Firma im zuvor festgelegten Rahmen zu halten.
Bei der taktischen Budgetplanung werden zu erreichende Unternehmensziele mit einem Fokus von bis zu fünf Jahren, also eher mittelfristig, verfolgt. Es werden mögliche Veränderungen und Schwankungen berücksichtigt und eingeplant.
Die langfristige Planung gilt als strategische Budgetplanung und ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren – in manchen Firmen bis zu zehn Jahren – ausgelegt. Dabei geht es um die zukunftsorientierte Ausrichtung eines Unternehmens.
Welche Methoden der Budgetplanung gibt es?
Die Top-Down-Budgetierung („von oben nach unten“) ist eine Methode, bei der die Gesamtausgaben und -einnahmen zuerst festgelegt werden. Das zur Verfügung stehende Budget wird von der Geschäftsleitung vorgegeben. Dazu werden die einzelnen Abteilungen und deren Bedürfnisse analysiert. Diese Methode ermöglicht es, ein Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und Ausgaben zu schaffen und zeitgleich kostensparend vorzugehen, da nur wenige Mitarbeitende in die Planung involviert sind.
Ein möglicher Nachteil ist die fehlende strategische Expertise von Fachkräften einzelner Abteilungen, deren Know-how nur bedingt einfließen kann. Diese Methode eignet sich für Firmen, die eine klare Vorstellung ihrer finanziellen Ziele haben. Die Ausgaben und Einnahmen können hierbei auf verschiedenen Ebenen verwaltet werden.
Die Bottom-Up-Budgetierung verfolgt den gegenläufigen Ansatz und beginnt auf der Ebene der Mitarbeitenden. Hier kann das Know-how von Führungskräften auf operativer Ebene zur Erstellung des Budgets genutzt werden, dafür ist der Koordinationsaufwand höher und es besteht die Möglichkeit, dass der gesamtstrategische Fokus aus den Augen verloren wird. Im Sinne des Teamgeistes ist Bottom up bei Mitarbeitenden beliebt, da viele Ebenen Mitspracherecht in der Planung haben.
Beim zero based budgeting wird das Budget jährlich komplett neu geplant. Ergebnisse oder Budgetpläne aus dem Vorjahr nehmen keinen Einfluss auf die neue Planung. Da hier nicht auf vorangegangene Planungen zurückgegriffen wird, können unnötige Ausgaben besser vermieden werden. Allerdings ist diese Verfahren sehr zeit- und arbeitsintensiv.
Bei der Budgetierung im Gegenstromverfahren handelt es sich um eine Kombination aus Top-down– und Bottom-up-Budgetierung.
Was gehört alles in die Budgetplanung?
Bei der Planung eines Budgets ist es wichtig, alle Arten an Einnahmen (z.B. Gehalt, Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen), Fixkosten (z.B. Miete, Kreditraten, Versicherungen) und variable Ausgaben (z.B. Wareneinkauf, Büromittel) sowie Rücklagen, Schulden (samt Tilgungsplänen) und Investitionen zu berücksichtigen.
Teilpläne der Budgetierung
Der Gesamtplan eines Budgets besteht aus mehreren Teilplänen, die alle wesentlichen Sektiren abdecken. Dazu gehören: Vertriebs-, Investitions-, Material, Produktions- und ein Stellenplan bzw. Personalplan.
Wie schreibe ich einen Budgetplan?
Zur Erstellung eines Budgetplans gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach Branche, Phase der Expansion und Größe der Firma gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Etablierte Big Player weisen normalerweise ein größeres Marketingbudget aus, als z.B. Start-ups, die zudem in der Seed-Phase auch nicht mit Gewinnen rechnen und oft durch Business Angels über Kredite finanziert werden.
Als Anhaltspunkte sollen aber die folgenden Schritte gelten:
1. Resümee des vergangenen Geschäftsjahrs
Wie liefen die Projekte im letzten Jahr? Welche Investitionen wurden getätigt? Waren die erstellten Budgets zielführend und wurden sie erfüllt? Wie verhielt es sich mit Einnahmen und Ausgaben? In welchen Abteilungen war der Budgetbedarf über der Kalkulation?
Ein Blick auf Zahlen, Kosten und die Situation der einzelnen Bereiche hilft dabei, die Planungsperiode für das kommende Jahr zum Erfolg zu führen. Die Kommunikation mit Budgetverantwortlichen und die effiziente Verteilung neuer Budgets ist essenziell.
2. Kalkulieren der Einnahmen
Um im Unternehmen den Überblick zu behalten, gilt es, die Umsätze und die daraus resultierenden Einnahmen zu kalkulieren.
3. Berechnen der Fixkosten
Um auf Dauer mehr einzunehmen, als aufgewendet wird, muss man die Ausgaben, also variable und fixe Kosten, im Griff haben. Zu diesen im Controlling als Overhead bezeichneten Fixkosten gehören meist Miete bzw. Pacht, Kosten für Personal, Hosting, Kredite, Zinsen, Versicherungen und Nebenkosten.
4. Berechnen der variablen Kosten
Die Kosten, die von Jahr zu Jahr variieren, sind Investitionen, Ausgaben für Marketing, Spesen, Software und Büroequipment. Zum Zweck der Budgetierung müssen beide Kostenarten addiert und mit den Einnahmen gegengerechnet werden. Muss eine Firma sparen, werden mehrheitlich zuerst die variablen Ausgaben gesenkt. Unregelmäßige Mehrausgaben (z.B. Übernahme) sollten separat ausgewiesen werden.
5. Notfallplanung
Ein Notfallfonds gilt als wichtiger Bestandteil der Finanzen einer Firma. So können unvorhergesehene Ausgaben (Reparaturen, unerwarteter Personalausfall bzw. Rechtsstreit) ausgeglichen werden. Ideal ist eine Rücklage von ca. drei bis sechs Monate der regelmäßigen Ausgaben.
6. Tilgungsplan bei Schulden
Sollte die Firma verschuldet sein, muss ein professionelles Schuldenmanagement erfolgen. Dabei hilft ein Tilgungsplan, der Höhe der Schulden, Fristen und Zinssätze aufschlüsselt.
Regelmäßigen Tilgungen sind als fester Budgetbestandteil zu sehen.
7. Überwachung und Anpassung des Budgets
Die regelmäßige Überprüfung des Budgets dient der Sicherstellung der Erreichung der finanziellen Ziele. Als wichtiges Instrument der Finanzplanung kann das Budget so bei Bedarf immer wieder an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Durch die Verwendung von Budgetplänen und -vorlagen kann die Überwachung und Anpassung effizienter gestaltet werden.
Fazit zur Budgetplanung
Mit der richtigen Budgetplanung und regelmäßigem Controlling kann die Liquidität eines Unternehmens und damit der Fortbestand gesichert werden. Zur Planung eignen sich Excel-Vorlagen, besser noch lassen sich diese Vorgänge automatisiert verwalten.
Ein zukunftsweisendes Tool für einfaches, schnelles und sicheres Finanzmanagement stellt die Business Management Software von Factorial dar. Verwalten Sie alle Unternehmensausgaben und Finanzen an einem Ort und finden Sie heraus, wo, wann und wie Sie am besten Zeit und Geld investieren.