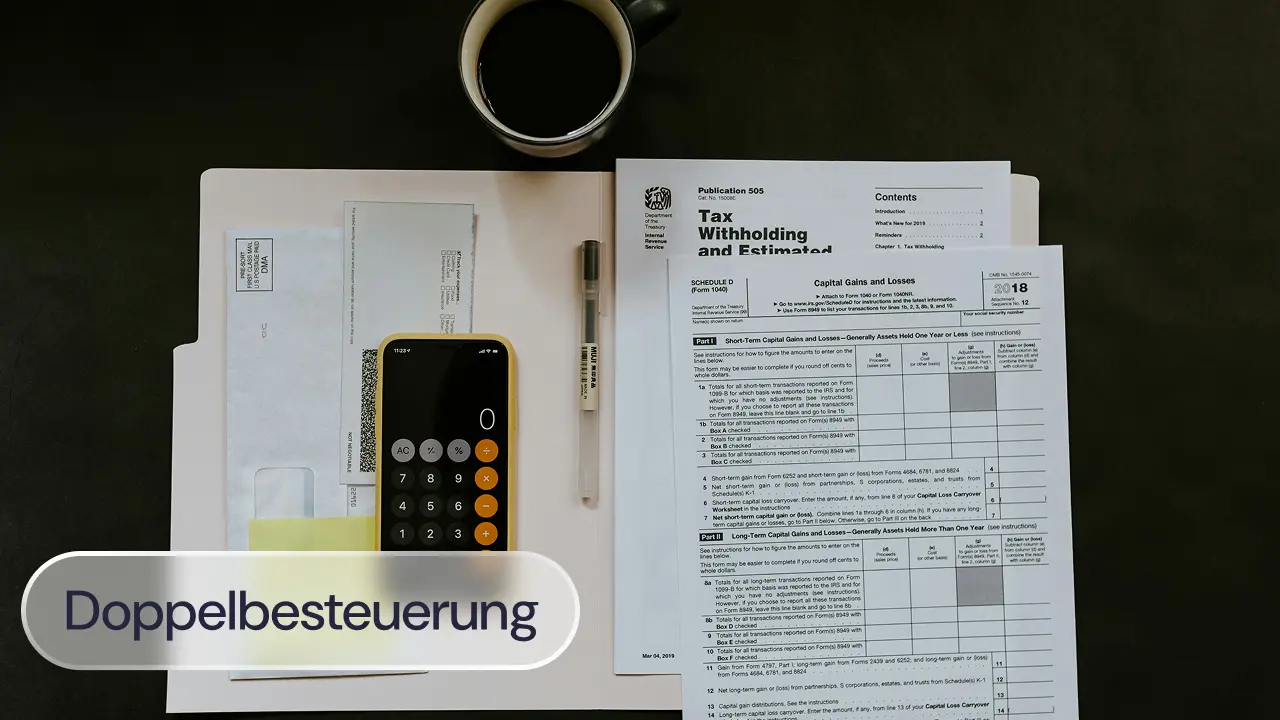Was bedeutet Honorarbasis eigentlich? Wie unterscheidet sich eine Honorarkraft von einer Freelancerin oder einem Freiberufler? Ob sich für Unternehmen eine Zusammenarbeit mit Honorarkräften lohnt, welche Kosten auf Arbeitgebende in diesem Zusammenhang zukommen und was es außerdem bei diesem Thema zu beachten gibt, beantworten wir im folgenden Artikel.
Key Facts
- Honorarkräfte arbeiten selbstständig auf Basis eines Honorarvertrages und erhalten für ihre Leistung ein Honorar, ohne in einem festen Arbeitsverhältnis zu stehen.
- Personen, die auf Honorarbasis arbeiten, sind also nicht angestellt und arbeiten oft für verschiedene Auftraggebende.
- Die Zusammenarbeit mit Honorarkräften bietet für Unternehmen Vorteile wie Flexibilität, Kosteneffizienz und Expertise für spezifische Projekte.
- Was ist Honorarbasis?
- Abgrenzung: Freelancer*innen, Freiberufler*innen und Honorarkräfte
- Gegenüberstellung: Arbeiten auf Honorarbasis vs. angestelltes Arbeitsverhältnis
- Arbeiten auf Honorarbasis – Das Honorar
- Rechtliche und steuerliche Regelungen
- Honorarkräfte im Unternehmen: Vor- und Nachteile
Was bedeutet Honorarbasis?
Arbeit auf Honorarbasis bedeutet, dass eine selbstständige Person, die sogenannte Honorarkraft, für die Erbringung ihrer Leistung ein Honorar erhält.
Honorarkräfte sind also nicht als Arbeitnehmende angestellt. Als Selbstständige arbeiten Sie in der Regel für verschiedene Auftraggebende.
Honorarkräfte werden oft auch als freie Mitarbeitende bezeichnet.
Abgrenzung: Freelancer*innen, Freiberufler*innen und Honorarkräfte
Auch wenn es sich bei all diesen drei Formen des Arbeitens um selbstständige Tätigkeiten handelt, gibt es doch feine, aber wichtige Unterschiede. Schauen wir uns die einzelnen Formen genauer an.
Freiberufler*innen
Bei Menschen, die eine freiberufliche Tätigkeit ausüben, handelt es sich zwar auch um Selbstständige, hiermit werden jedoch Personen mit ganz bestimmten Qualifikationen beschrieben.
In Deutschland ist Freiberuflichkeit gesetzlich definiert. § 18 des Einkommensteuergesetzes (EStG) legt fest, welche Tätigkeiten als freie Berufe gelten. Dazu zählen:
- wissenschaftliche,
- künstlerische,
- schriftstellerische,
- unterrichtende und
- erzieherische Tätigkeiten.
Konkrete Berufe, die darüber hinaus als freie Berufe gelten, sind:
- Ärzt*innen, Zahnärzt*innen und Tierärzt*innen,
- Rechtsanwält*innen, Notar*innen und Patentanwält*innen,
- Vermessungsingenieur*innen, Ingenieur*innen und Architekt*innen,
- Handelschemiker*innen, Wirtschaftsprüfer*innen und Steuerberater*innen,
- beratende Volks- und Betriebswirt*innen, vereidigte Buchprüfer*innen und Steuerbevollmächtigte,
- Heilpraktiker*innen, Krankengymnast*innen und andere Gesundheitsberufen,
- Journalist*innen, Bildberichterstatter*innen, Dolmetscher*innen und Übersetzer*innen,
- Lots*innen sowie weitere vergleichbare Berufen.
Diese Berufe haben einen besonderen Status. Sie sind daher auch von der Gewerbesteuer befreit.
Wichtig: Freiberufler*innen arbeiten in der Regel auch auf Honorarbasis. Das bedeutet: Die meisten Freiberufler*innen sind Honorarkräfte, aber nicht alle Honorarkräfte sind Freiberufler*innen.
Freelancer*innen
Im Gegensatz zu den freien Berufen ist der aus dem Englischen stammende Begriff „Freelancer“ nicht rechtlich geschützt. Häufig wird er verwendet, um Honorarkräfte im IT-, Content- oder Marketing-Bereich zu bezeichnen. Auch Freelancer*innen arbeiten auf Honorarbasis.
Freie Mitarbeitende
Ein weiterer Begriff für Solo-Selbstständige, die auf Honorarbasis arbeiten, ist der Ausdruck „freie Mitarbeitende“. Diese können sowohl als Freelancer*innen als auch als Freiberufler*innen tätig sein. Der Begriff ist ebenfalls nicht rechtlich geschützt.
Allerdings sind freie Mitarbeitende häufig stärker in ein Unternehmen eingebunden, da sie beispielsweise regelmäßig für dieses arbeiten. Vor allem in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie ARD, ZDF oder Deutschlandfunk ist die Beschäftigung freier Mitarbeitende ein gängiges Modell.
Fazit: Honorarkräfte können konkret ganz unterschiedlich definiert und eingesetzt werden, je nach Branche, Art der Tätigkeit und rechtlichem Kontext. Alle diese Gruppen können auf Honorarbasis arbeiten, sind jedoch durch unterschiedliche rechtliche, berufliche oder organisatorische Merkmale voneinander abzugrenzen.
Gegenüberstellung: Arbeiten auf Honorarbasis vs. angestelltes Arbeitsverhältnis
Im Folgenden möchten wir die konkreten Merkmale von Honorarkräften genauer betrachten. Zur besseren Verständlichkeit erfolgt dies in Form einer Gegenüberstellung zum Angestelltsein.
| Merkmal | Honorarkraft | Angestellter |
| Arbeitsverhältnis/Vertrag |
|
|
| Vergütung | Honorar für einzelne Projekte, Aufträge, Jobs oder Leistungen
(unregelmäßig) |
Fester Verdienst, also Lohn bzw. Gehalt
(in der Regel monatlich) |
| Sozialversicherung |
|
Arbeitgebende und Angestellte zahlen gemeinsam anteilig Beiträge zur Sozialversicherung |
| Arbeitszeit |
|
|
| Urlaub | Kein gesetzlicher Anspruch auf bezahlten Urlaub | Gesetzlicher Anspruch auf bezahlten Urlaub |
| Kündigung | Kein Kündigungsschutz | Kündigungsschutz nach Kündigungsschutzgesetz (KSchG) |
| Arbeitsort | Frei wählbar | In der Regel am Arbeitsplatz des Unternehmens |
| Ausstattung | Eigene Arbeitsmittel | Vom Betrieb gestellt |
| Steuern |
|
Vorgesetzte führen Steuern, wie die Lohnsteuer, für ihre Angestellten ab |
Arbeiten auf Honorarbasis – Das Honorar
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Honorar zu strukturieren. Die gängigen Arten sind:
Pauschalbetrag
Hierbei wird zwischen Auftraggebenden und Auftragnehmenden (den Honorarkräften) ein fester Betrag vereinbart, der nach Abgabe oder nach Abschluss eines bestimmten Projektes bzw. einer bestimmten Leistung gezahlt wird.
Beispiel: Eine freie Journalistin hat mit ihrem Auftraggeber X, einem bekannten Online-Magazin, einen Betrag von 500 Euro für das Schreiben eines 1.500 Wörter langen Artikels zum Thema Arbeitslosigkeit in Deutschland vereinbart. Nach Einreichen des Textes erhält sie ihr Honorar ausbezahlt. Für die Abgabe von anfallenden Steuern und Versicherungen ist sie selbst verantwortlich. Sie erhält diesen Festbetrag unabhängig vom Arbeitsaufwand, den sie für die Erstellung des Artikels betrieben hat.
Stundensatz
Besonders bei Freelancer*innen ist auch die Bezahlung auf Stundenbasis üblich. Hierbei vereinbaren beide Parteien einen festen Stundensatz. Je nach geleisteten Stunden für ein Projekt erhalten die Freelancer*innen die entsprechende Summe. Natürlich kann dieses Verfahren für Unternehmen riskant und eine Herausforderung sein, da die Gesamtkosten vorher nicht bekannt sind.
Beispiel: Eine Webdesignerin erhält für die Erstellung einer Website für die Firma einen Stundensatz von 70 Euro. Sie braucht dafür 30 Stunden. Sie bekommt 2.100 Euro für diesen Job.
Tagessatz
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Vereinbarung eines bestimmten Tagessatzes. Dies wird zum Beispiel häufig für Fotograf*innen angewendet. Für ihre Leistung wird beispielsweise ein Tagessatz von 1.000 Euro veranschlagt, unabhängig von den genauen geleisteten Stunden. Diese Methode wird besonders dann genutzt, wenn die Arbeitszeiten unregelmäßig sind oder der Arbeitsaufwand schwer zu kalkulieren ist.
Erfolgsabhängiges Honorar
Schließlich kann das Honorar auch an eine Bedingung gekoppelt werden. Das bedeutet, dass ein Teil des Honorars erst ausbezahlt wird, wenn ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Marke erreicht wurde – zum Beispiel, wenn ein bestimmter Umsatz erzielt oder eine gewisse Anzahl an Kund*innen gewonnen wurde. Diese Methode wird insbesondere im Vertrieb häufig angewendet.
Rechtliche und steuerliche Regelungen zur Arbeit auf Honorarbasis
Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte auf Honorarbasis zahlen alle ihre Sozialversicherungsabgaben selbst.
- Krankenversicherung: In Deutschland besteht die Versicherungspflicht für die Krankenversicherung. Diese gilt auch für Selbstständige. Entweder können Honorarkräfte also in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben oder sie können sich für eine Privatversicherung entscheiden.
- Rentenversicherung: Für die meisten Selbstständigen gibt es keine Rentenversicherungspflicht. Ausgenommen davon sind: Personen, die eine Lehrtätigkeit ausüben, bestimmte Gesundheitsberufe (wie Ergotherapeut*in), künstlerische und publizistische Tätigkeiten sowie bestimmte Handwerksberufe, die ein zulassungspflichtiges Handwerk betreffen (z.B. Friseur*in). Diese zahlen den aktuell vollen Rentenversicherungsbeitrag.
Hinweis: Die vollständige Liste finden Sie im § 2 SGB VI.
- Für alle anderen Versicherungen, wie die Arbeitslosenversicherung, besteht keine Versicherungspflicht für Honorarkräfte. Es ist jedoch ratsam, sich in dieser Hinsicht privat abzusichern – inbesondere was die Altersvorsorge angeht.
Steuern
Grundsätzlich müssen Selbstständige, die auf Honorarbasis arbeiten, ihr Einkommen vollständig selbst versteuern. Die genaue Besteuerung hängt von den aktuellen und sich ständig ändernden Gesetzeslagen ab.
Es gibt einige Erleichterungen, wie z. B.:
- Kleinunternehmerregelung: Nach dieser Regelung sind Kleinunternehmer*innen von der Umsatzsteuer befreit, wenn der Umsatz aus der Selbstständigkeit im vergangenen Jahr 25.000 Euro (Stand 2025) nicht überschritten hat und im laufenden Kalenderjahr 100.000 Euro nicht überschreiten wird. Dies ist in § 19 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) geregelt.
- Honorartätigkeit als Nebentätigkeit (Übungsleiterpauschale): Wenn Selbstständige eine Honorartätigkeit im Bereich der Aus- und Weiterbildung oder bei ehrenamtlichen Tätigkeiten ausüben, können sie von der Übungsleiterpauschale profitieren. Diese ermöglicht es, bestimmte Einkünfte bis zu einer festgelegten Obergrenze steuerfrei zu erhalten. Für das Jahr 2025 liegt die Obergrenze bei 3.000 Euro pro Jahr. Diese Regelung gilt für Tätigkeiten wie z. B. als Trainer*in, Übungsleiter*in, Dozent*in oder Ehrenämter.
Honorarkräfte im Unternehmen: Vor- und Nachteile
Wenn Sie sich als Arbeitgebender fragen, ob sich die Zusammenarbeit mit Honorarkräften für Ihr Unternehmen lohnt, kann Ihnen unser Überblick mit den Vorteilen und Nachteilen weiterhelfen.
Vorteile: Arbeit auf Honorarbasis
- Flexibilität: Ganz klar: Ein Pluspunkt für die Zusammenarbeit mit Honorarkräften ist die Flexibilität, die sie für Ihr Unternehmen bedeutet. So können Auftragsspitzen oder saisonale Schwankungen beispielsweise unkompliziert abgefangen werden. Der Einstellungs- und Kündigungsprozess ist oft einfacher, da es keinen Kündigungsschutz für diese Gruppe gibt. Die Zusammenarbeit kann nach Beendigung eines Projektes aufwandslos und einvernehmlich beendet werden.
Tipp 1: Honorarkräfte finden sich häufig über Mundpropaganda, aber auch auf Onlineplattformen. Wenn es beispielsweise um das Erstellen einer Website geht, bieten selbstständige Honorarkräfte auf Seiten wie Upwork oder Fiverr ihre Dienste an.
Tipp 2: Wie Sie einen Vertrag mit einer Honorarkraft aufsetzen, erfahren Sie in unserem Artikel zur freien Mitarbeit.
- Expertise: Manchmal fehlt es in einem Unternehmen für eine ganz bestimmte Angelegenheit an Expertise. Ein Klassiker hierfür ist wieder das Erstellen einer Website. In solchen Fällen handelt es sich oft nicht um eine Aufgabe, für die festangestellte Mitarbeitende erforderlich wären, da diese mit der Erstellung der Website abgeschlossen ist. Hier eignet sich besonders die Zusammenarbeit mit Honorarkräften, da diese gezielt für das Projekt hinzugezogen werden können, ohne dass eine langfristige Verpflichtung eingegangen werden muss. So kann das Unternehmen von spezialisierter Expertise profitieren, ohne dauerhaft Personal einstellen zu müssen.
- Kosteneffizienz: Selbstständige auf Honorarbasis gehören nicht zum Unternehmen und sind nicht angestellt. Das bedeutet, dass Betriebe keine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für diese zahlen müssen.
Nachteile beim Arbeiten auf Honorarbasis
- Hohe Stundensätze: Die Kosteneffizienz für Betriebe rentiert sich allerdings nur, wenn sie nicht zu lange mit Honorarkräften zusammenarbeiten. Die Stundensätze, die Honorarkräfte verlangen, sind oft hoch, da sie ihre eigenen Sozialversicherungs- und Steuerabgaben leisten müssen. Das bedeutet, dass es auf Dauer möglicherweise günstiger sein kann, eine Person befristet anzustellen. Dies hängt auch von der Tätigkeit ab: Freiberufliche Programmierer*innen verlangen oft hohe Honorare auf freiberuflicher Basis, ebenso beratende Personen. Für Bereiche wie Steuerberatung kann es sich jedoch eher lohnen, jemanden extern über einen längeren Zeitraum freiberuflich zusammenzuarbeiten.
- Rechtliche Unschärfe: Aufgepasst! Insbesondere, wenn Sie eine Honorarkraft über einen längeren Zeitraum beschäftigen, kann das Arbeitsverhältnis schnell in die Grauzone der Scheinselbstständigkeit rutschen. Das sollten Sie unbedingt vermeiden, da es zu schwerwiegenden Konsequenzen sowohl für Auftraggebende als auch für Auftragnehmende kommen kann. Lesen Sie mehr zu diesem Thema in unserem Artikel.
Tipp: Für eine effiziente Verwaltung all Ihrer Beschäftigten und der entsprechenden Abrechnungen empfiehlt es sich, Lösungen wie Factorial zu nutzen, die eine zentrale und fehlerfreie Gehaltsabrechnung, etwa dank der Marktplatz Schnittstellen-Partnerschaft mit DATEV, ermöglichen und die Kommunikation sowie Transparenz innerhalb des Unternehmens verbessern. Probieren Sie das Tool der vorbereitenden Lohnabrechnung noch heute aus!