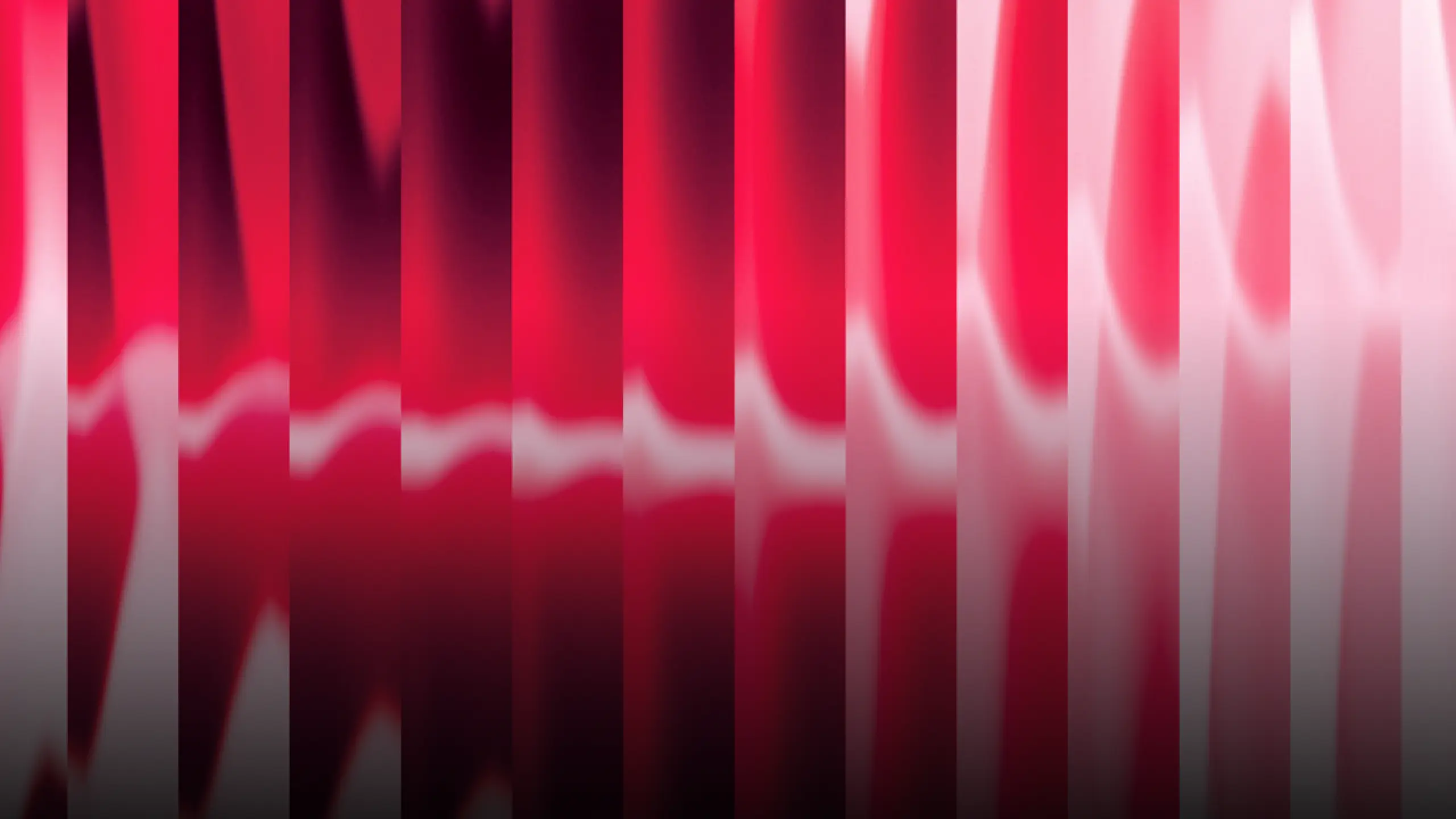„Finden Sie nicht auch, dass es höchste Zeit für Digitalisierungsmaßnahmen ist?“ Mit einer Suggestivfrage wollen Fragesteller*innen indirekt Einfluss auf die Antwort der Befragten nehmen. Die Frage ist also so formuliert, dass sie die Antwortmöglichkeiten der Befragten minimiert.
Suggestivfragen können daher im beruflichen Kontext ein wichtiges Mittel in Verhandlungen sein, aber auch manipulativ eingesetzt werden. Für eine sichere Rhetorik und einen souveränen Umgang mit Suggestivfragen ist es wichtig, ihren Aufbau zu kennen und vor allem zu wissen, wie man auf solche Fragen reagieren kann. Das erklären wir im folgenden Artikel.
Key Facts
- Suggestivfragen sind so formuliert, dass sie die Antwort in eine bestimmte Richtung lenken und damit Einfluss auf die Reaktion der Befragten nehmen.
- Im Gegensatz zu Suggestivfragen erwartet die rhetorische Frage überhaupt keine Antwort.
- Suggestivfragen zeichnen sich charakteristisch durch Elemente der Verstärkung, der Unterstellung, des emotionalen Appells und der Verallgemeinerung aus.
- Was ist eine Suggestivfrage?
- Aufbau von Suggestivfragen
- Suggestivfrage: Beispiel und Antworten
- Suggestivfragen im Beruf: Wann sollte man sie (nicht) einsetzen?
Was ist eine Suggestivfrage?
Bei einer Suggestivfrage handelt es sich um eine Frage, die so formuliert ist, dass sie versucht, die Antwort der Befragten bereits in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die Fragestellung soll Einfluss auf die Befragten nehmen und ihre Antwortmöglichkeiten verringern. Die Suggestivfrage wird also gezielt zur Beeinträchtigung und Manipulation im Gespräch eingesetzt.
Insbesondere im Berufsleben, beispielsweise in Verhandlungen, Meetings oder auch in Mitarbeiter- oder Verkaufsgesprächen, können Suggestivfragen zur Lenkung der Gesprächsführung gegenüber anderen genutzt werden. Es ist daher wichtig, Suggestivfragen zu erkennen, da sie uns häufig unbewusst beeinflussen. Erkennt man sie jedoch rechtzeitig, kann man besser reagieren und sich entsprechend positionieren.
Ursprung
Bereits der Ursprung des Wortes verrät seine Bedeutung. Der Begriff „Suggestivfrage“ stammt vom lateinischen Wort „suggerere“ ab. Das bedeutet so viel wie „darbringen“ oder „nahelegen“. Im Französischen entwickelte sich das Wort weiter zum Verb „suggérer“, was „vorschlagen“ bedeutet. Bei der Suggestivfrage geht es also darum, dass die Fragesteller*innen den Befragten die Antwort bereits vorschlagen.
Abgrenzung: Was ist der Unterschied zwischen einer rhetorischen Frage und einer Suggestivfrage?
Im Gegensatz zur Suggestivfrage, die eine spezifische Antwort vom Gegenüber erwartet, zielt die rhetorische Frage auf gar keine Antwort ab. Sie ist ein rhetorisches Mittel der Verstärkung und wird genutzt, um die eigene Zustimmung zu betonen oder ein Thema zu verstärken. Beispielhafte Sätze für rhetorische Fragen sind: „Wer kennt’s nicht?“, „Wer will denn nicht viel Geld haben?“, „Wer möchte denn nicht in einer besseren Welt leben?“
Aufbau von Suggestivfragen
Um zu verstehen, wann Ihnen jemand eine Suggestivfrage stellt, ist es nützlich, ihren Aufbau zu kennen. Anhand eines konkreten Beispiels aus dem Berufsleben erklären wir im Folgenden den Aufbau von Suggestivfragen.
Beispiel aus der Arbeitswelt
Im Unternehmen X wird gerade an einem großen Projekt gearbeitet, dessen Deadline kurz bevorsteht. Mitarbeiter Y hat eigentlich Feierabend, doch die Teamleiterin möchte, dass er länger arbeitet, um sicherzustellen, dass das Projekt rechtzeitig abgeschlossen wird. Sie ordnet es allerdings nicht direkt an – möglicherweise, weil sie in der Vergangenheit schon zu oft Überstunden angeordnet hat. Stattdessen möchte sie, dass der Mitarbeiter von selbst zu der Überzeugung gelangt, dass es besser wäre, heute länger zu arbeiten.
Sie fragt also: Glauben Sie nicht auch, dass es für den Erfolg des Projekts besser wäre, wenn Sie heute wie alle anderen auch länger im Büro blieben?
1. Unterstellung bzw. Annahme
Kernelement der Suggestivfrage ist dabei die Unterstellung bzw. die Annahme. Dabei versuchen die Fragesteller*innen indirekt ihre eigene Meinung zur Meinung der Befragten zu machen. Die Teamleiterin möchte beispielsweise, dass der Mitarbeiter länger arbeitet, weil sie findet, dass das Projekt so wichtig ist, dass er bleiben sollte.
Mit Verben wie meinen, glauben, denken oder auch möchten, in Kombination mit einer direkten Ansprache an die Befragten, versuchen die Fragesteller*innen im Gespräch also die Zustimmung des Gegenübers für ihre eigene Meinung zu erwirken.
2. Emotionaler Appell
Häufig wird darüber hinaus bei Suggestivfragen mit einem bestimmten drängenden Ton gearbeitet, der den Druck auf die Befragten erhöhen soll. In diesem Fall könnte der Tonfall der Teamleiterin freundlich, zugleich aber auch fordernd sein, was den Mitarbeiter dazu bewegen soll, sich verpflichtet zu fühlen, länger zu bleiben.
3. Verstärkung
Ein weiterer typischer Aspekt von Suggestivfragen ist die Verstärkung. Diese erfolgt durch die Nutzung bestimmter Adverbien wie „doch bestimmt“, „besser“, „schlechter“ oder „sicherlich auch“. Dadurch wird die Meinung der Fragesteller*innen klar suggeriert, und es wird zudem impliziert, dass die „richtige“ Antwort bereits feststeht.
4. Verallgemeinerung
Schließlich nutzt die Suggestivfrage häufig das Mittel der Verallgemeinerung, um den Druck weiter zu erhöhen. Der Verweis auf andere Personen gibt den Befragten beispielsweise zu wissen, dass bereits alle anderen auch zugesagt haben, länger zu bleiben.
Der Mitarbeiter Y hat im obigen Beispiel also kaum eine echte Chance, Nein zu sagen. Eine neutral formulierte Frage könnte hingegen so gestellt werden: „Könnten Sie sich vorstellen, heute länger zu arbeiten? So könnten wir sicherstellen, dass das Projekt rechtzeitig abgeschlossen wird.“ Hier hätte der Mitarbeiter tatsächlich mehr Spielraum, die Frage zu verneinen.
Doch da man sich im Berufsleben nicht immer aussuchen kann, welche Art der Fragetechnik unser Gegenüber einsetzt, wollen wir uns im Folgenden mit möglichen Antwortmöglichkeiten auf Suggestivfragen beschäftigen.
Suggestivfrage: Beispiele und Antworten im beruflichen Kontext
Wie können Sie nun reagieren? In einem Meeting hat Ihnen jemand vor dem gesamten Team eine Suggestivfrage gestellt, und Sie fühlen sich in die Ecke gedrängt. Hier gilt zunächst: Ruhe bewahren. Mit den folgenden Tipps meistern Sie solche Situationen mit Leichtigkeit.
Gegenfrage stellen und nach Klarheit fragen
Eine Suggestivfrage kann gut mit einer Gegenfrage beantwortet werden, oder aber auch mit einer Gegenfrage, die nach Klarheit fragt.
Im Meeting fragt der Chef den Abteilungsleiter: „Glauben Sie nicht auch, dass es besser wäre, wenn wir die Entscheidung jetzt sofort fällen, anstatt noch bis morgen zu warten?“
Hier könnte der Abteilungsleiter, statt direkt mit „Ja“ zu antworten, zunächst fragen, warum der Vorgesetzte der Ansicht ist, dass es besser wäre, die Entscheidung sofort zu treffen. Diese Nachfrage hilft, die Beweggründe hinter der Frage zu verstehen.
Suggestion überhören
Auch wenn eine Suggestivfrage den Befragten stets das Gefühl vermittelt, er hätte eigentlich keine wirkliche Wahl in seiner Antwort, ist das natürlich nur die gefühlte Wahrheit und nicht die tatsächliche. Statt also auf die Frage von Vorgesetzten an die HR-Abteilung, „Wie finden Sie, wir sollten an einigen Stellen Teams verkleinern, um Kosten zu sparen?“, einfach zuzustimmen, könnten Sie ganz sachlich antworten: „Nein, das finde ich nicht.“, und dann Ihre Argumente und Gründe anführen.
Eine klare Antwort vermeiden
Die Suggestivfrage versucht, Ihre Antwort in eine bestimmte Richtung zu lenken. Dies können Sie vermeiden – und sollten Sie es, insbesondere dann, wenn Sie noch keine klare Meinung zu dem jeweiligen zur Disposition stehenden Sachverhalt haben.
Frage: „Meinen Sie nicht auch, dass wir das Budget für das Marketing jetzt erhöhen sollten, um schneller sichtbare Ergebnisse zu erzielen?“
Anstatt einfach mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten, könnten Sie hier anführen, dass zunächst eine Analyse der aktuellen Kennzahlen im Bereich der Marketingabteilung durchgeführt werden sollte, um eine fundiertere Entscheidung zu treffen.
Tipp: Mit Factorial können Sie ganz einfach Reports und Analysen in verschiedenen Bereichen wie Finanzen oder Performance Ihrer Mitarbeitenden erstellen. Die HR-Software von Factorial ermöglicht es, Finanzanalysen durchzuführen, die dann grafisch übersichtlich aufbereitet werden. Auch Projektbewertungen sowie die Leistung und Effizienz einzelner Mitarbeitender und Teams können hier visuell und übersichtlich dargestellt werden. So haben Sie die perfekte Datenbasis für Ihre Entscheidungen.
Suggestion ansprechen
Schließlich bleibt Ihnen auch die Möglichkeit, die Suggestion direkt anzusprechen. Sie könnten auf eine Frage beispielsweise direkt antworten: „Diese Frage erscheint mir sehr suggestiv.“
Suggestivfragen im Beruf: Wann sollte man sie (nicht) einsetzen?
Suggestivfragen kommen in verschiedenen beruflichen Situationen zum Einsatz. Dabei müssen sie nicht unbedingt immer bewusst gestellt werden; oft werden sie auch gänzlich unbeabsichtigt verwendet. Gerade für Arbeitgebende und Führungskräfte ist es jedoch wichtig zu wissen, wann diese Frageform möglicherweise angebracht ist. Gleichzeitig ist es wichtig, zu wissen, wann sie auf gar keinen Fall verwendet werden sollte.
Einsatzmöglichkeiten von Suggestivfragen
- Kundenfeedback: Beeinflussen Sie Antworten in Umfragen gezielt, um spezifische Einblicke zu erhalten.
- Mitarbeitergespräche: Vorsicht bei Feedback- und Mitarbeitergesprächen – Suggestivfragen können ehrliches Feedback Ihrer Mitarbeitenden verzerren.
- Verhandlungen: Lenken Sie Gesprächspartner*innen subtil in die gewünschte Richtung, stärken Sie Argumente oder hinterfragen Sie Positionen.
- Marketing: Im Marketing sind Suggestivfragen eine bewährte Technik, um potenzielle Kund*innen zu beeinflussen
- Präsentationen: Suggestivfragen werden eingesetzt, um Zustimmung zu erzeugen und Argumente zu untermauern.
- Verkaufsgespräche: Fördern Sie Vertrauen, indem Sie Bedürfnisse der Kund*innen indirekt bestätigen.
Tipp: Workshops zu Rhetorik und Fragetechniken, wie es sie beispielsweise von Haufe Academics gibt, stärken Ihre Überzeugungskraft – etwa für Führungskräfte oder Verkaufsteams.