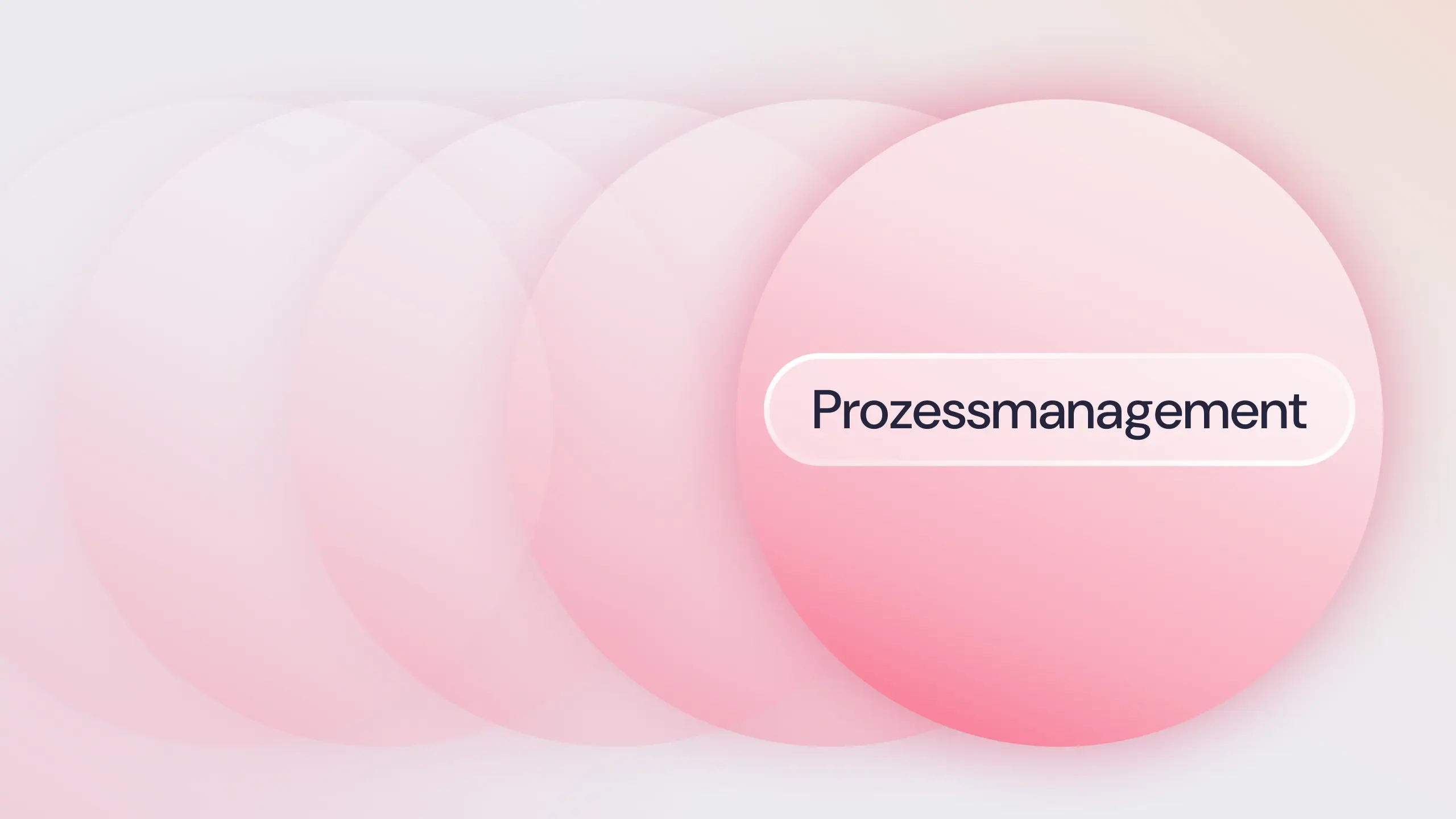Nonverbale und verbale Kommunikation hat wahrscheinlich schon jede*r einmal gehört. Aber was genau versteht man unter paraverbaler Kommunikation? Sie beschreibt, wie etwas gesagt wird – zum Beispiel Tonlage, Lautstärke oder Sprechtempo – und ergänzt damit die verbale und nonverbale Ebene. Gerade im Arbeitskontext ist ein fundiertes Verständnis davon, wie Kommunikation abläuft, besonders wichtig. Kommunikationsfehler treten hier häufig auf und können zu Problemen und Konsequenzen wie verpatzten Deadlines oder verschobenen Projekten sowie verminderter Produktivität führen.
Das Wichtigste in Kürze
- Paraverbale Kommunikation umfasst alle Elemente der Kommunikation, die beschreiben, wie etwas gesagt wird – zum Beispiel Lautstärke, Tonlage oder Aussprache.
- Neben der paraverbalen Kommunikation bilden die verbale und nonverbale Kommunikation die Grundlage dafür, wie Botschaften übermittelt und wahrgenommen werden.
- Gerade im Arbeitskontext zeigt sich, dass Kommunikation entscheidend für unternehmerischen Erfolg ist. Eine aktuelle Studie von TechSmith ergab, dass bei knapp 70 % der befragten Arbeitnehmenden gelegentlich durch Kommunikationsfehler Verwirrung während der Arbeit entsteht.
- Wie gute Mitarbeiterkommunikation geht und Sie aktiv zuhören, erfahren Sie unter anderem in unserem Kit zur Mitarbeitergesundheit ⬇️:
Definition: Was ist paraverbale Kommunikation?
Im Gegensatz zur verbalen und nonverbalen Kommunikation beschreibt die paraverbale Kommunikation die Art und Weise, wie etwas gesagt wird – also zum Beispiel in welcher Stimme oder Tonlage, mit welcher Lautstärke oder wie schnell etwas gesprochen wird. Ebenso wie die beiden anderen Formen der Kommunikation beeinflusst die paraverbale Ebene maßgeblich, wie unsere Worte auf das Gegenüber wirken und wahrgenommen werden.
Dabei werden paraverbale Signale kulturell und regional unterschiedlich verstanden. Sie entscheiden mit darüber, ob wir von unserem Gegenüber beispielsweise als sympathisch, freundlich oder eher als unfreundlich wahrgenommen werden.
Welche 3 Arten von Kommunikation gibt es? – Abgrenzung zu verbaler und nonverbaler Kommunikation
In der Kommunikationstheorie werden typischerweise drei Kommunikationsformen unterschieden. Sie beschreiben, wie Menschen Informationen austauschen.
- Verbale Kommunikation:
In der verbalen Kommunikation geht es um den konkreten Inhalt – also das, was gesagt wird: die Wörter, der Text.
Beispiel: „Schön, dass du da bist.“ – hier vermittelt der Satz direkt eine positive Botschaft.
- Nonverbale Kommunikation:
Die nonverbale Kommunikation umfasst alles, was nicht über Sprache vermittelt wird, sondern stattdessen durch Körpersprache, Gestik, Mimik oder Körperhaltung.
Beispiel: Derselbe Satz „Schön, dass du da bist“ kann durch eine freudige Mimik unterstützt werden – oder durch einen ausdruckslosen Blick völlig an Wirkung verlieren.
- Paraverbale Kommunikation:
Die paraverbale Kommunikation beschreibt, wie etwas gesagt wird: Tonlage, Lautstärke, Betonung, Sprechtempo.
Beispiel: Der Satz „Schön, dass du da bist“ mit verschränkten Armen und einem ironischen Unterton kann das genaue Gegenteil der eigentlichen Wortbedeutung ausdrücken.
Alle drei Kommunikationsformen zusammen ergeben den Gesamtcharakter einer Botschaft und beeinflussen, wie sie von unserem Gegenüber verstanden wird.
Schauen wir uns im Folgenden Beispiele für die paraverbale Kommunikation genauer an.
Was ist paraverbale Kommunikation: Beispiele?
Zur paraverbalen Kommunikation werden typischerweise folgende Elemente gezählt:
- Stimmlage:
Die Stimmlage hat einen entscheidenden Einfluss und gibt uns viel Auskunft darüber, wie die Stimmung des Gegenübers ist und wie die Aussage, die der Sprechende tätigt, gemeint sein könnte. Spricht jemand beispielsweise mit sehr hoher, schriller Stimme, kann das auf Aufregung oder Nervosität hinweisen. - Lautstärke:
Auch die Lautstärke spielt eine wichtige Rolle. Wut oder Ärger drücken sich oft in einer lauteren Stimme aus, während eine ruhige, entspannte Stimmung und Botschaft eher in einer sanften, leisen oder neutralen Stimme vermittelt werden. - Schweigen:
Auch Schweigen kann eine Botschaft sein – gerade, weil keine Worte gesprochen werden. Wenn jemand eine Frage stellt und die andere Person schweigt, kann das sehr unterschiedlich verstanden werden. Es könnte heißen, dass die Person nachdenkt und noch keine Antwort geben möchte. Es kann aber auch Ablehnung oder Desinteresse ausdrücken, wenn das Schweigen demonstrativ eingesetzt wird. - Aussprache:
Ob jemand deutlich oder undeutlich spricht, kann ebenfalls Einfluss haben. Eine sehr betonte, „distinguiert“ wirkende Aussprache kann gekünstelt wirken. Spricht jemand dagegen sehr schnell, deutet das häufig auf Aufregung hin.
Und was ist mit Lachen? Ist Lachen nonverbal oder paraverbal?
Lachen kann je nach Kontext sowohl nonverbal als auch paraverbal sein. Es kommt ganz darauf an, wie man es betrachtet.
- Nonverbal: Wenn Lachen die verbale Kommunikation nicht begleitet oder beeinflusst, ist es nonverbal. Ein Beispiel dafür wäre ein herzhaftes, lautes Lachen als Reaktion auf etwas, das ohne Worte kommuniziert wird, oder ein stilles Lächeln
- Paraverbal: Lachen wird in der Regel dann als paraverbal verstanden, wenn es die Art des Sprechens begleitet und beeinflusst. Ein gutes Beispiel ist ein kichernder Unterton, der die Bedeutung der gesprochenen Worte verändert oder verstärkt.
Paraverbale Kommunikation in der Arbeitswelt
Kommunikation in der Arbeitswelt ist das A und O – und genau hier entstehen viele Probleme: entweder, weil etwas missverstanden wird, oder weil wichtige Signale nicht richtig wahrgenommen werden. Das betrifft u. a. die interne Kommunikation, die HR-Kommunikation ebenso wie die Zusammenarbeit im Team. Einer aktuellen Studie von TechSmith zufolge gaben knapp 70 % der Befragten an, gelegentlich durch Kommunikationsfehler am Arbeitsplatz verwirrt zu sein, und die Hälfte berichtete, dass durch misslungene Kommunikation sogar Deadlines verschoben oder Projekte verzögert wurden. Misslungene Kommunikation stört also eindeutig den Arbeitsablauf und kann zu verminderter Produktion führen. Das zeigt, wie wichtig effektive Kommunikation im Berufsalltag ist.
Gerade in der HR-Arbeit ist ein umfassendes Verständnis von Kommunikation – und insbesondere von den drei Ebenen (verbal, nonverbal, paraverbal) – entscheidend. Denn sie bestimmen maßgeblich, wie Botschaften verstanden und interpretiert werden. Das ist vor allem wichtig bei:
1. Interviews und Bewerbungsgesprächen
In Bewerbungsgesprächen spielt die paraverbale Kommunikation eine große Rolle. HR-Mitarbeitende können hier oft „zwischen den Zeilen lesen“, wenn sie die einzelnen Zeichen der Kommunikation kennen.
- So sind Bewerber*innen in Vorstellungsgesprächen häufig aufgeregt, sprechen schneller als üblich oder verhaspeln sich. Hier ist es Aufgabe der Personaler*innen, möglichst ruhig zu bleiben und selbst durch eine klare, langsame und freundliche Stimme beruhigend auf das Gegenüber einzuwirken.
-
Gleichzeitig sollten Personaler*innen sich bewusst machen, dass paraverbale Signale auch verzerrend wirken können: Lautes Sprechen wird oft automatisch mit Selbstbewusstsein und Kompetenz assoziiert. Dadurch kann jemand, der eigentlich fachlich sehr kompetent ist, aber leiser spricht, fälschlicherweise als unsicher und weniger kompetent wahrgenommen werden.
Tipp: HR-Software wie Factorial kann dabei helfen, Verzerrungen im Bewerbungsprozess zu reduzieren. So lassen sich Bewerbungen mithilfe KI-gestützter Lebenslauf-Screenings effizient sichten, relevante Kompetenzen filtern und schon während des Gesprächs wertvolle Informationen über Bewerber*innen mithilfe anpassbarer Bewertungsformulare festhalten. Darüber hinaus bietet Factorial viele weitere Funktionen rund um das Bewerbermanagement und andere HR-Prozesse – eine umfassende digitale HR-Lösung für Ihr Unternehmen.
2. Paraverbale Kommunikation für Führungskräfte
Auch Führungskräfte sollten sich der Wirkung ihrer paraverbalen Signale bewusst sein. Eine Führungskraft, die undeutlich spricht oder sehr leise redet, wird möglicherweise von Mitarbeitenden nicht ernst genommen oder wirkt unsicher. Umgekehrt kann ein klarer, fester Ton Sicherheit, Orientierung und Führungsstärke ausstrahlen – unabhängig vom eigentlichen Inhalt der Worte.
3. Interkulturelle Kommunikation
Besonders für international agierende Unternehmen und Teams ist es wichtig, die kulturellen Unterschiede in der paraverbalen Kommunikation zu verstehen. In manchen Kulturen wird eine laute Stimme als Zeichen von Selbstbewusstsein und Durchsetzungsstärke gedeutet, in anderen hingegen als aggressiv oder unhöflich. Ebenso wird in Deutschland im Arbeitskontext präzises und knappes Sprechen geschätzt, während diese direkte und kurze Ausdrucksweise in anderen Ländern als unhöflich oder distanziert wahrgenommen werden kann. Wer diese Unterschiede kennt, kann Missverständnisse vermeiden und die Zusammenarbeit im globalen Kontext verbessern.
Tipp: Ein tieferes Verständnis weiterer Kommunikationsmodelle hilft, die unterschiedlichen Ebenen der Kommunikation besser einzuordnen und die Wirkung der eigenen Botschaften gezielt zu steuern. Lesen Sie dazu auch unseren Artikel, in dem wir die wichtigsten Kommunikationsmodelle vorstellen.