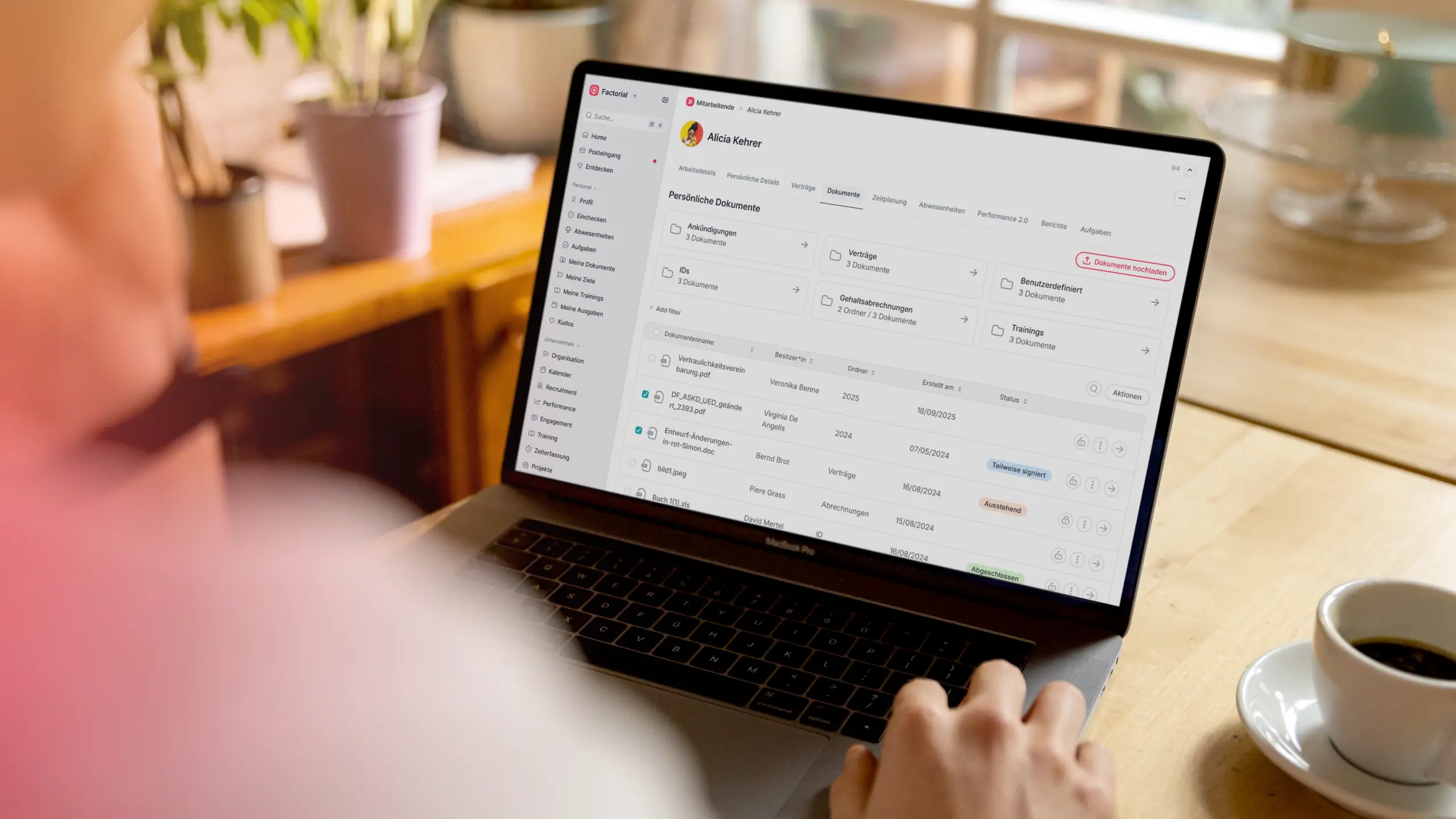Unternehmen arbeiten oft mit Auftragnehmenden zusammen, um bestimmte Leistungen zu erhalten. Dabei können sie auf einen Werkvertrag oder einen Dienstvertrag zurückgreifen. Aber worin liegen überhaupt die Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten und was muss ein Werkvertrag enthalten?
In diesem Artikel klären wir alles Wichtige rund um das Thema Werkvertrag.
Key Facts
- Bei einem Werkvertrag verpflichtet sich eine Partei zur Herstellung eines Werkes gegen Entgelt. Im Vordergrund steht dabei das fertige Werk, nicht die bloße Leistungserbringung.
- Im Unterschied zum Dienstvertrag, bei dem die Arbeitsleistung bezahlt wird, ist beim Werkvertrag das fertige Werk entscheidend für die Vergütung.
- Ein Werk im Sinne des Werkvertrages ist das Ergebnis einer Tätigkeit oder Dienstleistung. Es muss sich dabei nicht um ein materielles Produkt handeln.
- Was ist ein Werkvertrag?
- Werkvertrag: Voraussetzungen und Vertragsinhalt
- Abnahme des Werkes und Mängel
- Vergütung von Werkverträgen
- Werkvertrag: Kündigung
- Vor- und Nachteile eines Werkvertrags für Auftraggebende
- Werkvertrag: Muster
Was ist ein Werkvertrag?
Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, in dem sich eine Vertragspartei verpflichtet, ein Werk gegen eine Vergütung, dem Werklohn, herzustellen.
Der Vertrag wird also zwischen einem*r Auftraggebenden/Besteller*in und einem*r Unternehmer*in geschlossen. Kern eines solchen Werkvertrags ist dabei das Ergebnis und nicht eine regelmäßige, auf Zeit ausgelegte Dienstleistung.
Werkvertrag: Beispiel
Ein Werk im Sinne des Werkvertrages ist nicht immer ein materielles Produkt. In § 631 des Bürgerlichen Gesetzesbuches (BGB) ist festgelegt, was als Werk im Sinne des Werkes zu verstehen ist:
„Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.“
Werke im Sinne des Werkvertrages sind also beispielsweise:
- Erstellung eines Gutachtens
- Schneidern eines Kleides
- Reparatur eines defekten Laptops
- Herstellung von Bauwerken
- Planung einer Veranstaltung
- Entwicklung einer Software
Wichtig: Abgrenzung zu Werk im Urheberrecht
Das Werk im Sinne des Werkvertrages und das Werk im Sinne des Urheberrechts sind nicht notwendigerweise identisch. In einigen Fällen kann ein Werk, das aus einem Werkvertrag hervorgeht, jedoch urheberrechtlich geschützt sein.
Die Reparatur eines defekten Laptops beispielsweise wird kaum unter das Urheberrecht fallen. Handelt es sich bei dem Werk aber z. B. um die Erstellung einer Software, so kann der Werkvertrag ggf. mit einem Urheberrechtsvertrag gekoppelt werden, der dann auch die Nutzungsrechte des Auftraggebenden und eventuelle Erlösbeteiligungen beim Verkauf an Dritte regelt.
Wodurch unterscheiden sich Werk- und Dienstvertrag?
Neben dem Werkvertrag schließen Freiberufliche und Unternehmer*innen mit Auftraggebenden häufig auch Dienstverträge. Doch was ist der Unterschied?
Im Gegensatz zum Werkvertrag liegt der Fokus beim Dienstvertrag auf der Erbringung einer Tätigkeit. Das heißt, der Vertrag ist an eine Arbeitsleistung gebunden. Das Endergebnis ist für die Bezahlung und die Erfüllung des Vertrags irrelevant. Der Werkvertrag ist also erfolgsabhängig, wohingegen der Dienstvertrag leistungsabhängig ist.
Der Dienstvertrag ist in § 611 BGB festgelegt. Gegenstand eines Dienstvertrags können laut Gesetz „Dienste aller Art sein“.
Werkvertrag: Voraussetzungen und Vertragsinhalt
Nicht jede Person kann einen Werkvertrag abschließen. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Diese sind:
- Der Auftragnehmende muss selbstständig tätig sein.
- Der Auftragnehmende ist verantwortlich für die Erstellung des Werks. Dabei steht ihm frei, eigenes Personal einzusetzen.
- Der Vertrag ist mit der Fertigstellung und Abnahme des Werks beendet.
- Der Auftragnehmende ist nicht Teil des Unternehmens.
- Auftragnehmende setzen in der Regel ihre eigenen Arbeitsmittel ein.
Was gehört in einen Werkvertrag?
Wichtig: Damit ein Werkvertrag rechtssicher und vollständig ist, sollte er zuvor rechtlich abgesegnet oder bestenfalls von Rechtsexpert*innen aufgesetzt werden. Wichtige Punkte, die auf keinen Fall in einem Werkvertrag fehlen dürfen, sind:
1. Vertragsparteien (Name, Anschrift, Kontaktdaten)
2. Beschreibung und Nennung des Werkes
3. Beschreibung des Leistungsumfangs
4. Höhe des Werklohns und Fälligkeit
5. Fristen (Abgabe- und Abnahmefrist)
6. Garantie, Gewährleistung und Haftung im Falle von Mängeln
Abnahme des Werkes und Mängel
Der*die Werkunternehmer*in ist zunächst verpflichtet, das Werk mängelfrei abzuliefern.
Laut Gesetz gilt ein Werk frei von Mängeln, wenn es „die vereinbarte Beschaffenheit hat “. Gibt es im Vertrag keine Vereinbarung bezüglich der Beschaffenheit, dann gilt gemäß § 633 BGB:
Ein Werk ist frei von Sachmängeln,
- wenn es sich für die im Vertrag festgehaltene Verwendung eignet oder (wenn dies auch nicht festgehalten ist),
- wenn es sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und so beschaffen ist, wie es bei Werken ähnlicher Art der Fall ist.
Ist also das Werk mängelfrei, ist der Auftraggebende zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
Die Abnahme des Werks hat innerhalb einer bestimmten Frist zu erfolgen. Versäumen Auftraggebende diese Pflicht, so ist das Werk als abgenommen anzusehen und die Auftraggebenden sind zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet.
Was passiert im Falle von Mängeln?
Ist ein Werk nicht als mängelfrei zu bewerten, haben Auftraggebende und Auftragnehmende folgende Optionen:
- der Auftraggebende kann eine Frist zur Nacherfüllung festlegen. In dieser Zeit haben Auftragnehmende Zeit, die Mängel und Fehler zu beseitigen.
- dem Auftraggebenden steht es auch frei, die Mängel selbst zu beseitigen und vom Auftragnehmenden Ersatz für diese Aufwendungen zu verlangen.
- der Auftraggebende kann von dem Vertrag zurücktreten oder
- die vereinbarte Vergütung vermindern.
- Außerdem besteht unter Umständen die Möglichkeit, Schadensersatz oder Ersatz zu verlangen.
Einige Optionen sind nur unter gewissen Voraussetzungen möglich. Je nach Einzelfall muss geprüft werden, welcher Fall hier vorliegt. Genauere Auskunft hierzu gibt der § 634 BGB.
Vergütung von Werkverträgen
Die Vergütung des Werkvertrags erfolgt in der Regel nach Abnahme des Werkes. Das bedeutet, dass der*die Werkunternehmer*in in Vorleistung geht und erst nach Abnahme den Werklohn erhält.
Die Vertragsparteien können verschiedene Vergütungsmodelle vereinbaren. Welches Modell gewählt wird, hängt von der Art des Werkes ab. Je nachdem, ob es sich z. B. um die Herstellung eines Rucksacks oder um die Übersetzung eines Textes handelt, können unterschiedliche Vergütungsmodelle geeigneter sein.
Typischerweise kommen bei Verträgen wie dem Werkvertrag folgende Modelle vor:
- Vergütung nach Zeit/Aufwand: Bei dieser Variante werden der Material- und Zeitaufwand berechnet. Für den Auftragnehmenden impliziert diese Variante kein Kalkulationsrisiko hinsichtlich des Arbeitsaufwandes, da dieser immer voll vergütet wird. Für Auftraggebende bedeutet diese Variante jedoch ein erhebliches wirtschaftliches Risiko, da der Endpreis nicht vorhersehbar ist. Solche Vergütungsmodelle sind daher selten.
- Pauschalvergütung: Im Vertrag ist ein Pauschalbetrag vereinbart, mit dem alle erbrachten Leistungen abgegolten sind. Der Pauschalpreis bleibt unverändert, auch wenn sich bspw. Materialkosten während der Vertragslaufzeit ändern.
- Einheitspreisvergütung: Die Vergütung wird auf der Grundlage der tatsächlich erbrachten Leistungseinheiten berechnet. Diese Methode ist insbesondere im Baugewerbe und in anderen Bereichen, in denen der genaue Umfang der Arbeiten schwer vorhersehbar ist, weit verbreitet.
Werkvertrag: Kündigung
Beide Vertragsparteien haben das Recht, den Werkvertrag zu kündigen. Allerdings ist die Kündigung für den Auftraggebenden leichter als für die auftragnehmende Person.
Letzterer nur aus wichtigem Grund kündigen. Als ein solcher gilt:
„Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werkes nicht zugemutet werden kann.“
Eine Kündigungsfrist ist nicht einzuhalten.
Für den Auftraggebenden gilt laut § 648 BGB, dass er den Vertrag jederzeit kündigen kann. Der Auftragnehmende hat im Falle einer vorzeitigen Kündigung jedoch dann auch das Recht, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Angerechnet wird das, was er infolge der Kündigung an Aufwendungen spart.
Vor- und Nachteile eines Werkvertrags für den Auftraggebenden
Ein Werkvertrag kann für Auftraggebende sowohl positive als auch negative Seiten aufweisen. Schauen wir uns die verschiedenen Aspekte des Werkvertrags an:
Vorteile:
- Keine Sozialabgaben: Im Gegensatz zu den eigenen Mitarbeitenden müssen Auftraggebende für die Auftragnehmenden keine Sozialabgaben leisten.
- Flexibilität: Bei kurzfristigen Auftragsspitzen bspw. kann ein Teil der Arbeit flexibel an Werkunternehmer*innen ausgelagert werden.
- Haftung/Qualitätsgarantie: Der Auftragnehmende haftet für Mängel des Werkes. Das wirtschaftliche Risiko des Auftraggebenden ist also reduziert.
- Kompetenzen: Mit einem Werkvertrag können externe Kompetenzen und Ressourcen genutzt werden, die im eigenen Unternehmen nicht vorhanden sind. Benötigt ein Unternehmen zum Beispiel einmalig eine Übersetzung für eine Broschüre, lohnt es sich kaum, extra neues Personal mit den notwendigen Kompetenzen einzustellen. In diesem Fall ist es sinnvoller, eine*n freiberufliche*n Übersetzer*in auf Werkvertragsbasis einmalig mit der Übersetzung zu beauftragen.
Nachteile:
- Kein Einfluss auf die Arbeitsweise des Auftragnehmenden: Der Auftraggebende hat keinen Einfluss darauf, wie der Auftragnehmende das Werk erstellt.
- Abhängigkeit: Der Auftraggebende ist abhängig vom Auftragnehmenden. Das betrifft sowohl Fristeinhaltung als auch die Qualität des Werks.
Werkvertrag: Muster
Online finden sich viele Vorlagen für Werkverträge. Diese können Sie selbstverständlich nutzen. Es empfiehlt sich jedoch immer, diese für Ihren spezifischen Fall und Ihre Branche von Rechtsexpert*innen aufsetzen zu lassen. Nur so können Sie wirklich sicher sein, dass die Verträge korrekt und rechtssicher sind.
Muster und Vorlagen:
- Muster der IHK.
- Muster für Freelancer.
- Diverse Vorlagen der Kanzlei Liesegang & Partner.